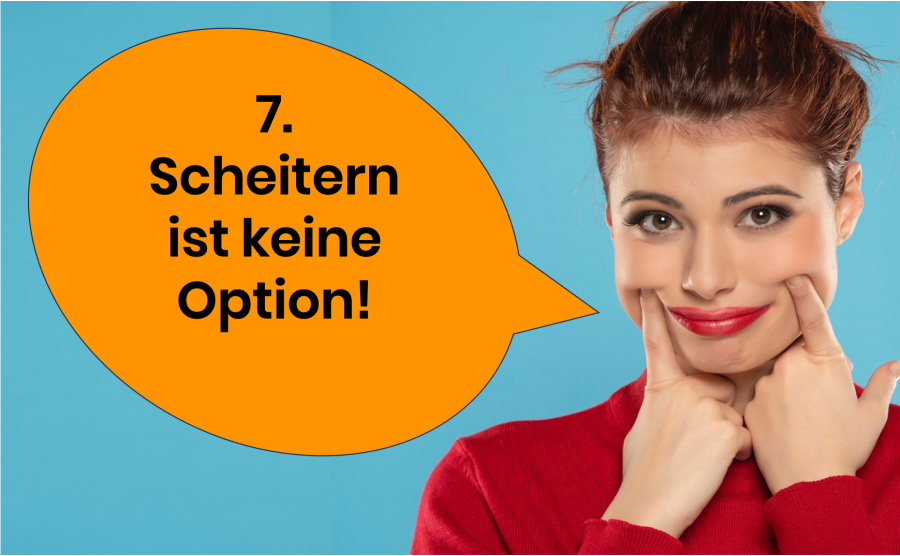Toxische Positivität: Streiche diese 7 Sätze aus Deinem Repertoire!
Was denken Sie, kann man zu gut drauf sein?
Optimismus an sich, ist ja eine Eigenschaft, die uns nachweislich länger und gesünder leben lässt. Sobald wir uns aber ausschließlich auf der Sonnenseite parken wollen und ignorieren, dass auch der Schatten existent ist, wird es eben ungesund.
Toxisch bedeutet ja schädigend und das ist dann der Fall, wenn jemand Positivität zur einzigen Option erklärt. Wenn negative Gefühle keinerlei Daseinsberechtigung mehr haben und alles Schmerzhafte ein positives Mäntelchen verpasst kriegen muss.
Sehen Sie hier, mit welchen sehr gebräuchlichen Formulierungen, wir der toxischen Positivität quasi den Teppich ausrollen. Das gilt für private Situationen, aber auch für berufliche, wo wir beispielsweise als Führungskraft die Kommunikationskultur in hohem Maße mitbestimmen.
Hier 7 typische Sätze:
Dieser Satz ist ein Paradebeispiel für toxische Positivität. Wenn wir Gefühle wie Trauer, Angst und Enttäuschung nicht zulassen, wenn sie auftauchen, dann ploppen sie in der Regel früher oder später wieder auf. Oftmals dann mit besonderer Wucht.
Wenn wir über etwas traurig sind, dann ist es viel heilsamer, Tränen zuzulassen, als das Gefühl rational zu verklären. Wenn wir uns über eine Sache ärgern, dann kann es richtig sein, das möglichst direkt anzusprechen.
Oft kann man einer Krise in der Retrospektive auch etwas Positives abgewinnen, aber wann das soweit ist, entscheidet jeder selbst. Dieser Zustand der Akzeptanz lässt sich nicht vorwegnehmen. Er tritt ein, wenn jemand mit dem Verarbeitungsprozess soweit ist.
Wenn wir es gut mit unserem Gegenüber meinen, dann könnten wir also stattdessen sagen: „Ich verstehe, dass die Situation sehr schwer ist und wenn ich unterstützen kann, tue ich das gerne.“
Ja, meist gibt es schon Schlimmeres, aber wer beispielsweise schon mal Liebeskummer hatte, weiß, dass so ein Spruch noch weniger hilft, als Vanilleeis mit Schokosoße. Zumal das Empfinden von Leid eine höchst subjektive Angelegenheit ist. So sehr wir es manchmal wollen, wir können nicht nachempfinden, was ein anderer fühlt.
Wer darauf hinweist, dass es noch Schlimmeres in der Welt gibt, der möchte das Leid für den Betroffenen schmälern. Aber stattdessen schmälert man mit diesem Satz vielmehr die Berechtigung, sich über das empfundene Leid zu beklagen.
Dabei reicht es meist aus, ganz ohne tröstende Worte, einfach da zu sein und zuzuhören, wenn jemand seine Sorgen mit uns teilt.
Eine Ausnahme vielleicht: wenn wir „Es gibt Schlimmeres“ zu uns selbst sagen. Da relativieren wir nämlich unseren eigenen Kummer und das kann wiederum helfen, das Bedrohungs-Potenzial einer Situation, realistischer einzuschätzen.
Wenn wir unser Mitgefühl ausdrücken wollen, dann rutscht uns so ein Satz schon mal über die Lippen. Manchmal fühlen wir uns spontan ermuntert, ähnliche Situationen aus unserem Leben mitzuteilen, mitsamt all den positiven Lehren, die wir daraus ziehen konnten.
Das Problem dabei: wir sprechen nur über uns selbst, statt zuzuhören und helfen damit unserem Gegenüber oft nicht wirklich weiter.
Ich habe diesen Punkt mit meiner Tochter diskutiert und sie meinte dazu: „Okay, aber wenn mir jemand von sich erzählt, können ja auch gute Anregungen dabei sein und ich erfahre, dass auch andere schon in so einer Situation gesteckt haben."
Das stimmt natürlich, ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht. Ich denke, das ist eine Frage der Balance in den Redeanteilen. Man sollte den anderen nicht abwürgen, um seine eigene Geschichte zu erzählen.
Erstmal ist das eine gewagte These! Denn nicht alles wird immer gut. Und wenn, dann ist es oft ein weiter Weg, bis es wieder gut ist! Wer sich beispielsweise in einer Lebenskrise befindet, spürt das auch instinktiv. Wenn dann jemand sagt:„Alles wird gut“, dann kommt er mit dieser Botschaft kaum durch; das klingt einfach zu weit weg in einem Moment voller Sorgen.
Oder der Satz wird so aufgenommen, dass man sich nicht ernst genommen fühlt. Stattdessen lohnt es sich, das Leid einfach als solches anzuerkennen. Schwierige Momente und zermürbende Phasen gehören zum Leben dazu – warum sie nicht als solche benennen und sagen:„Ja, es ist gerade alles ziemlich doof.“
Das nimmt den Druck aus dem Anspruch, sich schnellstmöglich wieder gut fühlen zu müssen.
Natürlich darf auch der gute alte Schicksalsplan nicht fehlen, das Karma oder die Seelenaufgabe. Wenn wir selbst nach dem Sinn einer Erfahrung suchen und jemand unterstützt dabei, dann ist das eine gute Sache. Aber, jemanden, der durch eine schwierige Phase geht, auf einen möglichen Plan hinzuweisen, ist nicht hilfreich.
Jemand der beispielsweise eine lebensverändernde Diagnose bekommt, wird das erstmal verdauen müssen, bis da vertieft reflektiert werden kann. Im Moment der Krise sehen wir nur bis zur Nasenspitze. Und der Schicksalsbegriff wirkt dann wieder relativierend, als wäre unser Problem nicht groß genug, um sich darüber zu beklagen. Vermittele Deinem Gegenüber doch stattdessen, dass Du das Problem ernst nimmst und bereit bist, zu unterstützen. Mehr braucht es oft gar nicht.
Vom Schicksal direkt zur „Alles ist machbar-Strategie“. Ja, wir können unsere Denkweise aktiv verändern. Allerdings passiert das meist, nachdem wir Krisen überstanden haben und nicht mittendrin.
Der Glaube an eine allumfassende Machbarkeit hat erstmal etwas sehr Motivierendes. Es bedeutet ja: Wow, alles ist drin!
Wenn aber alles eine Einstellungssache ist, dann ist auch klar, wer die Schuld hat, wenn man etwas nicht schafft. Offensichtlich hatte man das falsche Mindset. Da wir mit unserer inneren Haltung aber eingebettet sind in ein kollektives Gefüge, sind wir auch abhängig von den Umständen. Und die können günstig und manchmal auch ungünstig sein.
Wenn man also jemandem Mut machen will, dann ist diese Parole - zumindest in ihrer Absolutheit - ein Schwindel. Eine gute Alternative: Einfach mal nichts sagen.
Scheitern ist nicht nur eine Option, sondern eher so etwas wie ein Naturgesetz. Lernen und Weiterentwicklung finden nicht trotz des Scheiterns statt, sondern durch das Scheitern. Die Dynamik dahinter: Trial & Error oder Versuch und Irrtum. So lernen wir Laufen, Autofahren oder Mitarbeitergespräche führen.
Da, wo Scheitern keine Option ist, bleiben Menschen meist in ihrer Komfortzone. Und das ist schade: man verpasst womöglich wunderbare Begegnungen und lehrreiche Erfahrungen.
Also streichen Sie diesen Satz einfach aus Ihrem rhetorischen Repertoire. Wer sich etwas getraut hat, ein Risiko eingegangen ist und einen Misserfolg verkraften muss, darf auch enttäuscht sein. Wenn jemand dann später nochmal „angreift", vielleicht mit einem überarbeiteten Konzept, dann ist das sicher unterstützenswert.
Aber, alles zu seiner Zeit.
Negative Gefühle, wie Traurigkeit, Wut, Neid oder Scham erfüllen einen wichtigen adaptiven Zweck: Sie helfen uns dabei, die Herausforderungen unseres Alltags zu meistern, indem sie für unterschiedliche Situationen das passende Verhaltensrepertoire bereitstellen.
Sie lenken unsere Aufmerksamkeit auf Warnsignale, die wir erkennen müssen, oder Umstände, die uns schaden. Wie soll man denn sonst auf die Idee kommen, dass man beispielsweise mit der Arbeitssituation unzufrieden ist.
Bei Trauer ist vielleicht Rückzug wohltuend, bei Wut kann die Konfrontation richtig sein und bei Neid, kann man sich fragen, wo man sich gerade selbst ausbremst.
Vielleicht passt als Motto: Jedes Gefühl hat seine Berechtigung! viel besser.
Wenn wir das Konzept akzeptieren können, dass Gefühle ein liebevoller Hinweis aus unserem Inneren sind, dann wäre es doch schade, das nicht zu nutzen.
Menschen, die vielfältige Gefühle nuanciert wahrnehmen können, scheinen psychisch und physisch gesünder zu sein. Jetzt weiß man nicht, ob Gesunde mehr fühlen oder ob „mehr fühlen“ gesund macht. Das ist diese Sache mit der Henne und dem Ei.
Aber es gibt Hinweise, dass ein ausgewogener Gefühlsmix uns davor schützt, dass unser emotionales Ökosystem zu sehr von einzelnen Gefühlen dominiert wird.
Wer zum Beispiel immer nur traurig ist, läuft Gefahr, eine Depression zu entwickeln. Kommen jedoch andere Emotionen, beispielsweise die Wut hinzu, kann das eine Person davor bewahren, sich allzu in der Niedergeschlagenheit zu verlieren.
Fazit: Wir könnten ganz bewusst,
- alle auftauchenden Gefühle nuanciert wahrnehmen,
- unangenehme Gefühle nutzen und
- positive Gefühle intensiv auskosten,
in der Gewissheit, dass sie nicht für immer bleiben – auch nicht mit dem großartigsten Mindset.