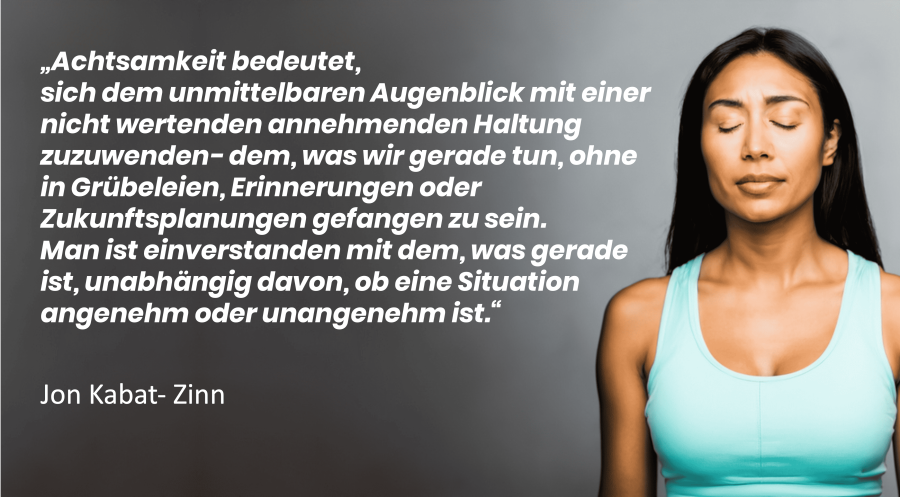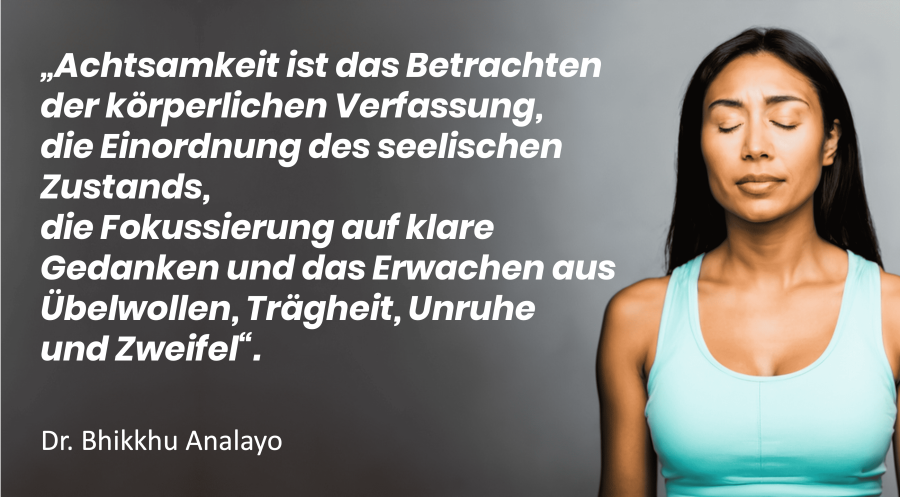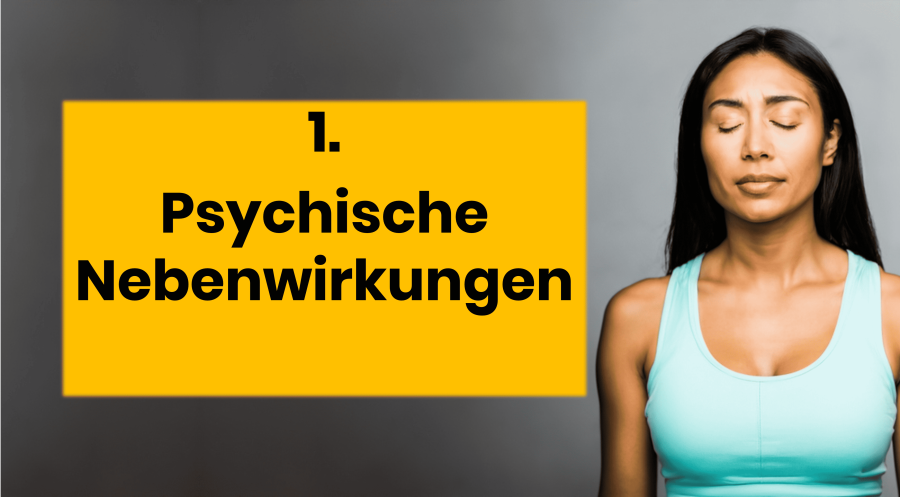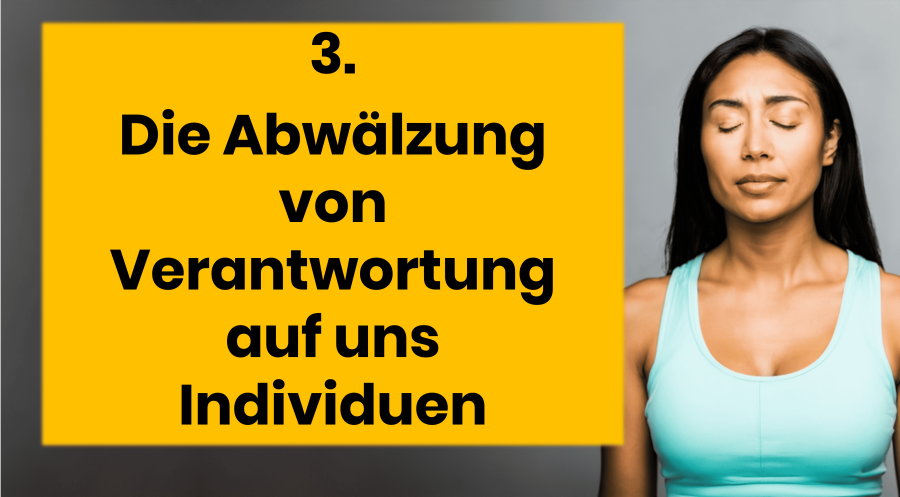„Achtsamkeit" mit unerwünschten Nebenwirkungen?
Die Achtsamkeit als Konzept erlebt schon seit ein paar Jahren einen echten Boom. Die AOK schreibt auf ihrer Website:
Das Konzept Achtsamkeit soll Stress reduzieren und die Lebensqualität steigern.
Zahlreiche Studien belegen die positiven Wirkungen von Achtsamkeitstrainings und Meditation. Sie gehören zur Routine in etlichen Unternehmen und sind ebenso wirksamer Bestandteil von Psychotherapien, beispielsweise der „Achtsamkeitsbasierten kognitiven Therapie, kurz MBCT genannt (engl.: mindnessful-based cognitive therapy).
Aus Erfahrung wissen wir jedoch, dass alles was wirkt, auch Nebenwirkungen haben kann. Die wichtigsten drei Nebeneffekte möchte ich hier vorstellen.
Denn wer die Stolpersteine kennt, kann sich auf dem Pfad der Achtsamkeit noch sicherer bewegen.
Was ist eigentlich Achtsamkeit?
Eine eher westliche Definition kommt von Jon Kabat- Zinn, Begründer der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion (MBSR).
Ein Buddhist würde es offensichtlich anders formulieren. Dieses „Erwachen wollen“ in seiner Formulierung -als Beispiel für den spirituellen Bezug- finden wir im westlichen Verständnis kaum noch und das kann man finden, wie man will.
Festhalten können wir:
Keine Meditation kommt ohne Achtsamkeit aus, aber man kann achtsam sein, ohne zu meditieren.
Kommen wir zu den unerwünschten Nebenwirkungen:
Millionen Menschen in Deutschland meditieren regelmäßig. Die Angebote reichen von Achtsamkeits-Apps über Onlinekurse bis hin zu mehrtägigen sog. Retreats. Laut einer Umfrage von Statista hat fast jeder Vierte im Alter von 18 bis 64 Jahren eine Meditationsapp auf seinem Smartphone.
Neuere wissenschaftliche Untersuchungen zeigen aber, dass intensive Meditation auch schwere psychische Nebenwirkungen auslösen kann.
Die US-amerikanische Psychologin Willoughby Britton von der Brown University konnte in einer zehnjährigen Langzeitstudie nachweisen:
Jeder zehnte Meditierende entwickelt Nebenwirkungen, die ihn im Alltag stark einschränken.
Angst, traumatische Flashbacks und Hypersensibilität waren dabei die häufigsten Nebenwirkungen.
Eine Studie einer Arbeitsgruppe der Charité Berlin stellte anhand von knapp 1.400 meditierenden Probanden fest:
- Insgesamt 22 Prozent erlebten unerwünschte Effekte,
- 9 Prozent davon wurden als mild und vorübergehend eingestuft,
- 13 Prozent hatten moderate bis extreme negative Effekte.
Manche Personen brauchten eine Behandlung oder es war sogar ein Krankenhausaufenthalt nötig.
In Deutschland gibt es seit drei Jahren eine erste Anlaufstelle für Opfer von Meditationsnebenwirkungen am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg.
Die Sprechstunde wird bereits stark genutzt und die Psychologen dort vermuten eine hohe Dunkelziffer und einen großen Beratungsbedarf.
Achtsamkeitsübungen und Meditation sind also durchaus positiv und hilfreich, aber nicht für jeden oder jede in allen Lebenslagen.
Wer sich psychisch instabil, angeschlagen oder massiv gestresst fühlt, sollte vielleicht eher über eine kompetente therapeutische Begleitung nachdenken und sich erst danach in gestärkter Verfassung auf den Pfad der Achtsamkeit begeben.
Als Manager-Mindfulness bezeichnet man den Einsatz von Achtsamkeitsübungen zur Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit. Man will vordergründig neuen Raum für Kreativität und Energie schaffen. Das ist durchaus positiv, aber wer Mindfulness-Meetups und Achtsamkeit-AGs einführt, um mehr Effizienz aus den Mitarbeitern zu pressen, regt eher zur Selbstausbeutung an als zur Achtsamkeit.
Es verleiht einem Unternehmen einen hippen Anstrich und ist viel leichter umzusetzen als die Reduzierung von Arbeitslast, angemessene Bezahlung oder flexible Arbeitszeiten.
Wer meditiert, allein um noch besser zu funktionieren, macht aus der Achtsamkeit eine bloße Konzentrationsübung und klammert andere sehr wünschenswerte Erfahrungen aus. Beispielsweise die akzeptierende, liebevolle Haltung zu sich selbst und auch zu anderen- jenseits aller Leistungsansprüche.
Also, nicht überall, wo Achtsamkeit draufsteht, ist auch Achtsamkeit drin.
Ein Großteil psychischer Probleme entsteht durch Stress, Überforderung, Existenzangst, Diskriminierung und weitere Faktoren, auf die man oft wenig Einfluss hat.
Stress wird dabei aber zunehmend pathologisiert und privatisiert. Nicht die Umstände sollten verändert werden, sondern das Individuum muss resilienter werden.
Das führt dazu, dass sich Menschen mit Stresssymptomen oder psychischen Beschwerden nicht nur schlecht, sondern auch schuldig fühlen – weil sie offensichtlich noch nicht alles getan haben, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
Achtsamkeit kann bei der Stressvermeidung helfen, aber nicht jeder Stressor lässt sich alleine durch Meditation auf ein tolerables Maß reduzieren. Nicht alle Probleme können wir in uns selbst lösen.
Ich bin ein großer Fan von Meditation und Achtsamkeitspraxis, aber manchmal kann es auch clever sein, statt achtsam ein Mandala zu malen, lieber eine gepfeffertes Schreiben an den Betriebsrat aufzusetzen oder dem garstigen Kollegen „die Meinung zu geigen".
Wir können achtsam und zentriert sein, aber das bedeutet nicht, sich gegenüber JEDER Situationen in Akzeptanz zu üben.